| Stefan Seidendorf | |||
| Europäisierung nationaler Identitätsdiskurse? |
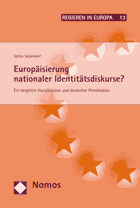 |
||
| Ein Vergleich französischer und deutscher Printmedien | |||
| Regieren in Europa ; 13 | |||
| 390 S., Baden-Baden, Nomos, 2007 | |||
| ISBN: 978-3-8329-2268-9 | |||
|
Gehe zum |
||
Abstract
Die Entwicklung einer europäischen Identität gilt, je nach normativem Standpunkt, als unmöglich oder unabdingbar. Allerdings gibt es kaum empirische Studien über die inhaltlichen Veränderungen von Identitätsvorstellungen seit Beginn der Integration. Diese Arbeit sucht nicht nach der "einen europäischen Identität" und will auch nicht das "Identitätsgefühl" der Europäer erheben. Vielmehr steht die Europäisierung nationaler Identitätendiskurse im Mittelpunkt. Dazu wird der in vier Zeitungen erhobene Identitätsdiskurs der Anfangsjahre der Integration mit der Gegenwart verglichen. Die Arbeit versteht Identität als diskursive Konstruktion, die sich in Massenmedien über Abgrenzung, Identifikation und inhaltliche Verortung zeigt und richtet sich sowohl an Politik- und Sozialwissenschaftler, als auch an Historiker und "Praktiker" der Integration.Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Die "No Demos"-These
2. Ein alternatives Modell – "Einheit in
der Vielfalt"
3. Europäisierung nationaler Identität: ein sozialkonstruktivistischer
Ansatz
4. Diskursanalyse von Identität
5. Zusammenfassung – Ausblick auf die
Arbeit
Kapitel 1 – Überlegungen zur Konstruktion von Identität
1.1. Zugangsmöglichkeiten zu persönlichen und kollektiven
Identitätskonstruktionen
1.2. Ansätze aus der Sozialpsychologie: Individuelle und
kollektive Identität
1.3. Ansätze der historischen Nationalismusforschung
1.3.1. Vormodernes Nationenverständnis
1.3.2. Modernes Nationenverständnis – Nationalismus
1.3.3. Der Nationalismus als Geistesbewegung
1.4. Gemeinsame Geschichte als Bindeglied
1.4.1. Kollektives Gedächtnis und Erinnerungsorte
1.5. Nationalstaatliche Identität zwischen Demos und Ethnos
1.5.1. Legitimität demokratischer Prozesse zwischen Demos und Ethnos
1.5.2. Politische Identität und Nation in Frankreich und Deutschland
1.5.3. Alternativen zum nationalstaatlichen Modell?
Kapitel 2 – Veränderung von Identität durch Europäisierung
2.1. 'Europäisierung' als analytischer Rahmen
2.1.1. Überblick: Verschiedene Konzepte von Europäisierung
2.1.2. Europäisierung nationaler Identität: Anpassungsdruck, Passförmigkeit und vermittelnde Faktoren
2.1.3. Europäisierung repräsentativer Demokratie
2.1.4. Passförmigkeit: welche Elemente sind dem Anpassungsdruck ausgesetzt?
2.1.5. Vermittelnde Faktoren: Soziale Praxis, transnationale Kommunikation und Akteure des Wandels
2.2. Diskursanalyse als Methode
2.2.1. „Kritische Diskursanalyse“
2.2.2. Regeln des Diskurses, soziale Praxis und Forschungsansätze
2.3. Konstruktionen und Konstrukteure: Die Dialektik nationaler Identität
2.3.1. Der "Lebenszyklus nationaler Identität"
2.3.2. Kommunikation nationaler Identität – Eliten- und Massenphänomen
2.4. Forschungsdesign: welche Medien, welche Akteure, welche Debatten?
2.4.1. Wo findet Identitätskonstruktion statt? – Codes und Prozesse
2.4.2. Situationen – Wann und wo findet Identitätskonstruktion statt?
2.4.3. Thesen zur Veränderung nationaler Identität durch Europäisierung
Kapitel 3 – Nationale Identität zu Beginn der Integration (1952)
3.1. Die Ausgangslage in Frankreich und Deutschland
3.1.1. Frankreich
3.1.2. Deutschland
3.1.3. Europa
3.2. Selbstbilder – Der Einfluss der Vergangenheit, die Ungewissheit der Zukunft
3.2.1. Frankreich
3.2.2. Deutschland
3.2.3. Fazit Selbstbilder
3.3. Begegnungen – Erfahrungen, Fremdbilder, neue Chancen
3.3.1. Vergangene Erfahrungen und ihre aktuelle Bedeutung
3.3.2. Bestehende Stereotypen
3.3.3. Zukünftige Chancen
3.3.4. Fazit Begegnungen
3.4. Grenzkonstruktionen – Begegnungen in Europa
3.4.1. EVG und Westvertrag: Einbindung und Souveränitätsdelegation
3.4.2. Zankapfel Saar: Erinnerungen und neue Ansprüche
3.4.3. Das gemeinsame Europa: Föderalisten und eine 'Konstituante'
3.4.4. Fazit Europaberichterstattung
3.5. Fazit der Fallstudie 1952
Kapitel 4 – Europäische Identitätsdiskurse im Jahr 2000
4.1. Selbstbilder 2000
4.1.1. Frankreich: Republik, Souveränität, Regionalisierung
4.1.2. Deutschland: Leitkultur, Länderkompetenzen, deutsche Interessen
4.1.3. Zusammenfassung Selbstbilder 2000
4.2. Begegnung in der Vergangenheit? Österreich und die EU-Sanktionen
4.2.1. Das 'gemeinsame Andere' der 'Wertegemeinschaft EU'
4.2.2. Resonanz über Emotionalisierung: Frankreich und 'Nazi Haider'
4.2.3. Frankreich, Haider und das 'Problem Deutschland'
4.2.4. Das Ende der Krise – die Wahrnehmung muss angepasst werden
4.2.5. Fazit: eine europäische Selbstverständigung zwischen nationaler und politischer Wahrnehmung
4.3. Gemeinsame Grenzkonstruktionen: Fischer, Chirac, die 'Zukunft Europas'
4.3.1. Joschka Fischer: Vom Staatenbund zum Bundesstaat?
4.3.2. Jacques Chirac: Eine Verfassung für Europa?
4.3.3. Die europäische politische Debatte: "Gralshüter der Staatstheorie" gegen europäische Konstitutionalisten
4.3.4. Die Zukunft Europas – Zusammenfassung
4.4. Europas Selbstverständnis im Jahr 2000: Europäisierte Vergangenheits-, europäische Zukunftsdebatten?
Kapitel 5 – 1952 – 2000: Transformation von Identitätsdiskursen?
5.1. Selbstbilder 1952 – 2000
5.1.1. Frankreich
5.1.2. Deutschland
5.1.3. Europäische Selbstbilder?
5.2. Fremdbilder 1952 – 2000
5.2.1. Begegnungen
5.2.2. Abgrenzungen
5.3. Grenzkonstruktion Europa 1952 – 2000
5.3.1. Grenzkonstruktionen 1952
5.3.2. Grenzkonstruktionen 2000
Fazit der Arbeit: Auf dem Weg zum europäischen Demos?
Literaturverzeichnis und
Anhang
Literaturverzeichnis
Aufsätze und Monographien
Internetquellen
Anhang
Anhang I: Benutzte Charakterisierungen in der Haider-Debatte
Informationen zum Autor:
Stefan Seidendorf studierte in Tübingen, Aix-en-Provence und Brügge
Geschichte, Romanistik und Europäische Politik- und Verwaltungswissenschaft.
"Europäisierung nationaler Identitätsdiskurse?" ist seine Promotion, die von 2002-2005 am
Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) entstand und von Prof. Dr.
Beate Kohler-Koch und Prof. Dr. Frank Schimmelfennig betreut wurde. Seit 2005 arbeitet Seidendorf
an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Mannheim, zunächst am
Lehrstuhl für Internationale Beziehungen und Europäische Integration, seit Februar 2007
am Lehrstuhl für Politische Wissenschaft und Zeitgeschichte (Prof. Rittberger).