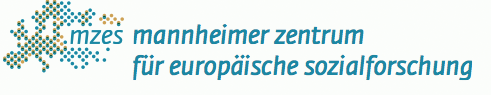Das Projekt untersucht die Determinanten und Folgen von Appellen politischer Akteure an soziale Gruppen und deren Einfluss auf die demokratische Politik. Es zielt darauf ab zu verstehen, warum, wann und wie politische Parteien und einzelne Abgeordnete in ihrer Rhetorik auf gesellschaftliche Gruppen verweisen – sowohl während Wahlkämpfen als auch in Parlamentsdebatten – und welche Auswirkungen solche Gruppenappelle auf Wähler*innen und demokratische Repräsentation haben. Die Forschungsziele des Projekts sind (1) die Typen und Dimensionen von Gruppenappellen zu konzeptualisieren und ihre Verbreitung sowie ihre Funktionen für den Parteienwettbewerb im Wahl- und Parlamentskontext zu erklären, (2) individuelle Determinanten gruppenbezogener Rhetorik zu untersuchen, die von Abgeordneten in parlamentarischen Reden verwendet wird, und (3) die Auswirkungen von Gruppenappellen auf Wähler*innen zu analysieren.
Aufbauend auf Erkenntnissen aus der Parteienforschung, der politischen Kommunikation, der politischen Psychologie und der Repräsentationsforschung möchte das Projekt verstehen, wie politische Akteure Gruppenansprachen strategisch einsetzen – nicht nur, um kurzfristige Wahlkoalitionen zu bilden, sondern auch, um langfristige Narrative über Identität, Zugehörigkeit und Repräsentation zu gestalten. Unter Einsatz fortgeschrittener computergestützter Textanalyse in einem umfangreichen, mehrsprachigen Korpus von Wahlprogrammen (1970–2025) und Parlamentsreden (1990–2023) verknüpft das Projekt angebotsseitige Strategien mit nachfrageseitigen Reaktionen, die anhand von Beobachtungsdaten und Umfrageexperimenten gemessen werden. Das übergeordnete Ziel ist es, das wissenschaftliche Verständnis des strategischen Einsatzes von Gruppenansprachen, ihrer Variation in unterschiedlichen Kontexten sowie ihrer Folgen für politische Repräsentation und das Wahlverhalten zu vertiefen. Der erwartete Beitrag ist ein vergleichender, longitudinaler Datensatz sowie neue theoretische und empirische Erkenntnisse, die verdeutlichen, wie Gruppenrhetorik Wählerkoalitionen, politische Debatten und gesellschaftliche (De-)Alignments prägt. Dieser Fokus ist besonders relevant angesichts aktueller Entwicklungen in vielen Demokratien, darunter Veränderungen in den Parteiensystemen, wachsende politische Polarisierung und die zunehmende Bedeutung rechtsradikaler und populistischer Akteure.
Das Projekt ist eine Zusammenarbeit mit Hauke Licht von der Universität Innsbruck im Rahmen des WEAVE-Lead-Agency-Verfahrens. Es wurde im Mai 2025 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und dem österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) für eine Laufzeit von drei Jahren bewilligt. Der Projektstart ist für Februar 2026 geplant.